Expedition tief in das unbekannte venezolanisch-brasilianische Grenzgebiet zu einem unberührten Stamm der Yanomami Indianer.


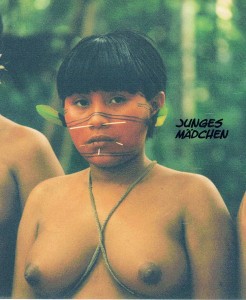
Allgemein:
Yanomamis sind Halbnomaden. Sie leben gemeinschaftlich in großen Rundhäusern, die Shapono genannt werden, und legen Gärten an, sie sind aber auch Jäger. Ihre Gruppen können bis zu 120 Angehörige umschließen. Das gesamte Leben spielt sich in der Öffentlichkeit ab, mit Ausnahme des Geschlechtslebens und der Notdurft . Die Yanomami besitzen kein eigenes Zahlensystem, mit „eins“, „zwei“ und „viele“ kommen sie aus. Zu- und abnehmender Mond bestimmen ihren Lebensrhythmus. Traditionsgemäß tragen sie keine Kleidung und bemalen ihre Körper mit Schlangen und Kreismustern, wofür sie eine rote Paste aus Onoto-Samen verwenden. Das schwarze Haar tragen sie als gleichmäßigen Rundschnitt, mit oder ohne Tonsur. Mädchen und Frauen schmücken sich mit durch Unterlippe, Wangen oder Nase gestoßenen Stöcken. Die Yanomami gelten als recht aggressiv, ebenso kommen Vergewaltigungen häufig vor. Da die Gärten und das Umfeld eines Shapono nur einen begrenzten Zeitraum Nahrung bieten, müssen sie in regelmäßigen Abständen wochenlange Stammeszüge, sogenannte Trecks, unternehmen. Wahrend ihrer Abwesenheit erholt sich die Natur an den zurückgelassenen Stellen wieder. Während der Trecks wird das gesamte Hab und Gut, das aber meist nicht sehr umfangreich ist, auf dem Rücken getragen. Das Rad wurde bei den Yanomami noch nicht erfunden, auch die Metallverarbeitung ist noch unbekannt. Das Leben der Yanomami ist hart, fast brutal, wir bekamen es am eigenen Leib zu spüren …
Die Tour:
Im World Wide Web entdeckte ich eine Anzeige, die mein Interesse weckte. Es wurden Teilnehmer für eine Expedition zu den Yanomami im Grenzgebiet von Brasilien und Venezuela gesucht. Die Vorbereitungen waren so gut wie abgeschlossen. Ich nahm Kontakt auf und beschloss, nach einem Treffen in Frankfurt, mitzufahren. Zwar Organisiere ich meine Abenteuerreisen grundsätzlich selbst, aber ich dachte nicht immer muss ich der Häuptling sein. Der wichtigste Grund jedoch, vor Jahren hatte ich schon mal etwas ähnliches geplant, aber viele unerreichbare Auflagen der Funai, (Indianerbehörde Venezuela) Liesen mich bald scheitern. Der Expeditionsleiter hatte jedoch einen Deutschen aufgetan der wiederum für einen hohen Beamten in Venezuela arbeitet der offensichtlich in der Lage war jede Genehmigung gegen bares zu ermöglichen. Meine Erwartungen und Einstellungen zu Touren mit unbekannten Leuten sind ziemlich klar: Ich halte es mit nahezu jedem ein paar Wochen aus, wenn man ein gemeinsames Ziel für die Tour formulieren kann. Unser gemeinsames Ziel war das Gebiet um den Rio Siapa herum mit dem Besuch eines Shapono einer Gruppe noch relativ unberührt lebender Yanomami.
Mit LH ging es nach Caracas von dort nach Puerto Ayacucho, mit einer kleiner Maschine weiter nach Tamatama. Nun folgen wir im Boot Humboldts Spuren, erst den Orinoco entlang, um dann in den Brazo Casiquiare abzubiegen. Südamerika und insbesondere den Regenwald kannte ich bereits aber schon in Tamatama musste ich lernen hier ist es etwas anders! Die Piri Piri und alle weiteren auf der Welt bekannten Insekten haben hier auf uns gewartet. Um Blut zu saugen, wo immer sie eine unbedeckte Stelle am Körper fanden. Aber selbst die Strümpfe über die Hosen gesteckt, langarmige Hemden und Mützen tief ins Gesicht gezogen nutzten wenig, dann eben in das Nasenloch, wie gut wäre hier eine dieser lächerlichen Hüte mit Moskitonetz rundrum.



Bevor wir den Rio Siapa stromaufwärts fuhren, besuchten wir ein erstes Dorf der Yanomami. Ein ursprüngliches Shapono gab es dort nicht mehr, sondern jeder bewohnte seine eigene Hütte. Bald wusste ich auch warum. Reiseanbieter bringen Touristen hierher um ihnen die Yanomami in Ihrem natürlichen Lebensraum zu zeigen. Hier sollten Träger zu uns stoßen und es kam zu ersten Problemen.
Das erste war die Wasseraufbereitung. Ich trinke nur im äußersten Notfall und auch wirklich nur dann, ungefiltertes Wasser aus einem Fluss. Und wir hatten keine Wasserfilter dabei. Erstaunt musste ich jedoch vom Expeditionsleiter hören, dass die hier nicht nötig seien! Da ich mich ungern auf andere verlasse, hatte ich aber ein paar Mittelchen zur Wasserentkeimung dabei, man weiß ja nie!
Die nächste Schwierigkeit hing mit den Trägern zusammen. Mehrmals war im Vorfeld versichert worden, jeder habe einen eigenen Träger zur Verfügung, entsprechend hatte ich meine Ausrüstung geplant. Vor Ort standen dann aber nur zwei Träger für insgesamt sechs Leute zur Verfügung. Aber auch auf diese Unwägbarkeit war ich vorbereitet und hatte einen kleinen, wasserdichten Rucksack dabei um mein Habe Notfalls selbst tragen zu können…



Wir verbanden zwei Kanus miteinander um die ganzen Vorräte und die zusätzlichen Männer an Bord unterzubringen und dann ging es den Siapa hinauf bis zu einem Wasserfall, ab dort mussten wir dann zu Fuß weiter. Ich verstaute das Allernötigste im Rucksack und gab lediglich das Zelt zum Tragen ab.
Mich traf fast der Schlag, als ich sah, was die beiden Träger alles schultern mussten, darunter waren ganze Aktenkoffer mit kompletten Filmausrüstungen. Der Yanomami konnte mit dem Gepäck auf dem Rücken gar nicht mehr alleine aufstehen, wir mussten ihn hochhieven. Dann lief der arme Kerl los um erschöpft wie ein Käfer auf dem Rücken liegend auf uns zu warten und wieder auf die Beine gestellt zu werden. Mein Gott halte dich zurück, du bist nicht der Häuptling, nur ein Indianer in der Truppe. Immer öfter muss ich mich zurückhalten.
Das Gelände stellte sich als sehr anspruchsvoll heraus, zudem regnete es ununterbrochen. Es waren unzählige kleine Flussläufe zu überwinden, als Einziger schaffte ich es, die schmalen, als Brücke dienenden Bäume darüber zu benutzen. Die anderen mussten in die Flussbetten steigen und durch das oft hüfttiefe Wasser waten. Die erste der beiden mitgeschleiften Filmausrüstungen war bereits nach zwei Stunden nur unnützer Ballast, nach einer unfreiwilligen Tauchübung des Besitzers! Die nächste am Abend, nichts ging mehr, zu feucht zu heiß, die Elektronik schaltet zum Eigenschutz aus!
So wundert es nicht das die allgemeine Stimmung bereits am ersten Tag auf den Nullpunkt sank. Aber was hatten die Leute erwartet? Ein weiterer Punkt waren die Mahlzeiten! Nun weiß jeder das ein gutes Abendessen durchaus wichtig ist, den Stress des Tages mildert die Stimmung hebt und wertvoll ist um bei Kräften zu bleiben. Der Expeditionsleiter hat jedoch die Menuwahl an den uns begleitenden Deutschen, der die Tour organisiert hat, delegiert. Und so gab es grässliche Dinge wie etwa eine Dose Sardinen mit zwei aus Mais geformten Knödeln. Wenn es sein muss, aber auch nur dann, kann ich durchaus ein paar Tage gar nichts essen ohne zu verzweifeln. aber es musste ja nicht sein!
Ich war froh, mich für ein Zelt entschieden zu haben, denn so konnte ich wenigstens die Nacht über Kraft schöpfen. Drei Tage lang wanderten wir durch den Dschungel, bis wir auf eine große Gruppe Yanomami stießen. Sie befanden sich auf dem Treck und wir durften nach Übergabe einiger Geschenke bei ihnen bleiben.







Drei faszinierende Tage lang blieben wir an dieser Stelle und konnten beobachten, wie die Gruppe ihr Dschungelcamp aufbaute – ohne dafür eine Schnur oder ein sonstiges fremdes Hilfsmittel zu verwenden. Alles Mögliche wurde dazu aus dem Dschungel herangeschleppt. Einige Frauen gingen in der Zeit Beeren sammeln, während andere Frauen den ganzen Tag in der Hängematte lagen. Das Zusammenleben folgt einer strengen, nach außen nicht leicht zu entschlüsselnden Hierarchie. Auch unsere Geschenke wurden nur an bestimmte Familien verteilt, das System der Vergabe blieb mir verborgen.
Einer unserer Yanomami Träger kam eines Nachmittags mit einem geschossenen Affen zurück. Es machte wenig Freude, das Tier im Kochtopf zu sehen, diese kleinen Hände die Füße … Nein danke, auf diese Mahlzeit verzichtete ich!
In der darauf folgenden Nacht wurde es laut im Camp. Es ist durchaus normal, dass ein Yanomami auch einmal mitten in der Nacht aufsteht, um laut zu erzählen, wenn er ein Mitteilungsbedürfnis hat. Jetzt aber hörte ich ununterbrochen ein Kind schreien und als ich aus dem Zelt kroch, konnte ich einem Schamanen beim Heilen zusehen. Nach außen hin sichtbar tat er nichts anderes, als die offensichtlich schmerzende Stelle mit Grunzlauten zu „besprechen“ und anschließend mit beiden Händen eine wegwischende Bewegung zu vollziehen. Das Zeremoniell erstreckte sich über eine Stunde in immer wiederkehrender, gleichförmiger Eintönigkeit. Auf diese Weise sollte wohl dem Körper das „Böse“ entzogen werden. Am nächsten Tag erkundigte ich mich genauer nach dem Ritual. Wenn ich es richtig verstand, werden dazu kaum Kräuter oder andere spezielle Dinge zur Heilung verwendet.
Fast jede Yanomami-Familie hat „Haustiere“, meist Vögel, es gibt aber auch kleine Affen und einmal entdeckte ich eine kleine abgemagerte Hündin mit ihren Welpen. Der Umgang mit den Tieren ist allerdings hart und roh, ich sah in den paar Tagen viele von ihnen sterben. Auch der Umgang der Menschen miteinander ist recht rau, so schreien die Kinder schon einmal, bis sie blau anlaufen, ohne dass sich jemand um sie kümmert. Aus der Sicht eines Europäers wirkt dieses Verhalten sehr befremdlich, aus der hiesigen Perspektive wird sie zumindest nachvollziehbar. Die Yanomami müssen ausnahmslos jeden Tag ums Überleben kämpfen, das Leben im Regenwald ist hart und herausfordernd.





Heute Morgen kam es zum Streit. Ich wollte weiter bis zum Shapono, aber der Expeditionsleiter lehnte ab, er mochte nicht weiterlaufen. Das ärgerte mich ziemlich, denn an diesen Ort werde ich wohl so schnell nicht mehr zurückkommen. Die Gruppe beschloss, mit den Yanomami weiter zu ziehen, die ebenfalls unsere Richtung einschlagen wollten. Es sollte jedoch anders kommen. Während ich bereits mit einer Handvoll Yanomami ins Tal abgestiegen war und dabei die Leichtigkeit und Geschmeidigkeit bewundert hatte, mit der sie sich im Dschungel fortbewegten, hörte ich von weiter oben aus dem Camp laute Rufe.
Mick, der Arzt aus unserer Gruppe, ließ uns zurückbeordern. Als ich zurückkehrte, fand ich Mick vor einer Hängematte sitzend, auf der ein Yanomami lag. „Der Mann stirbt“, sagte Mick trocken. „Mist, was kannst du machen?“, fragte ich ihn, aber er antwortete nicht. „Sollen wir ihm von unseren Antibiotika geben?“, wollte ich von ihm als Arzt wissen. „Das siehst Du zu einfach“, sagte Mick, „Medizin ist ein komplexes Thema, außerdem sind sie die Leute hier nicht gewohnt und es könnte dem Mann erst recht schaden.“ „Also“, insistierte ich, „was können wir tun?“ „Nichts“, antwortete er wieder. „Okay, Mick, wenn er so oder so stirbt, dann könnten wir es doch zumindest mit einer kleinen Dosis Antibiotika zur Linderung seiner Leiden versuchen, oder nicht?“ „Du hast recht, aber er wird es wohl gleich wieder erbrechen.“ Wir ließen eine Suppe kochen, schmuggelten unbemerkt eine Dosis Doxycyclin darunter und gaben sie dem Mann zu trinken. Dann baten wir einen unserer Träger, zum Stammeschef zu gehen, um den Schamanen zu schicken. Obwohl der Kranke nicht transportfähig war, bestand der Chef darauf, dass man den Sterbenden zum Schamanen brächte, der bereits losgezogen war und unten im Tal wartete. Unten angekommen, starb der Yanomami vor unseren Augen, die Frauen des Stammes schrieen und jammerten darauf unaufhörlich.
Nun machte ich Druck, wir müssen verschwinden, zu schnell könnte ein Zusammenhang mit uns und dem toten Yanomami hergestellt werden.
All sei nichts geschehen, ließ sich der Stammesführer die von uns die versprochenen Geschenke aushändigen und verabschiedete uns, das laute Wehklagen der Frauen klang uns noch lange in den Ohren nach.
Auch in unserer Gruppe kam es dann zu Schwierigkeiten, als eine Frau – die einzige in unserer Gruppe – physisch und psychisch völlig am Ende, zusammenbrach. Sie weinte und schluchzte nur noch, war nicht mehr fähig aufzustehen. Der Expeditionsleiter wohl auch am Ende seiner Möglichkeiten stand nur hilflos herum . Ich schaffte es schließlich, sie zu beruhigen und durchwatete von da an mit ihr an der Hand die Flüsse, zog sie Anhöhen hinauf und half ihr über Baumstämme hinweg, redete ihr unentwegt Mut zu.
Derart und von den vielen neuen Eindrücken beansprucht, kam eine positive Rückbesinnung bei mir erst zustande, als wir wieder auf dem Rio Negro unterwegs waren. Erst da konnte ich mich sogar ein wenig über diese Tour freuen. Um ein Fleckchen Erde und viele zwischenmenschliche Erfahrungen reicher kehrte ich damals aus dem Regenwald nach Hause zurück …







Hinterlassen Sie eine Antwort
Sie müssen angemeldet sein, um einen Kommentar abgeben zu können.